
Viele Hebammen schwören darauf und auch im Internet ist die Empfehlung auf zahllosen Seiten zu finden: Himbeerblättertee für eine „leichte“ Geburt. Manche raten täglich 2-3 Tassen ab der 34. Schwangerschaftswoche. Andere empfehlen eine Tasse ab der 37. Schwangerschaftswoche, aber besser nicht täglich, damit die Wirkung nicht zu stark ist. Aber welche Wirkung eigentlich? Folgende positive Effekte werden dem Tee nachgesagt:
- Er soll die Muskulatur des kleinen Beckens (lt. manchen Quellen auch des Beckenbodens) stark lockern
- Er soll die Darmaktivität anregen, in dem die glatte Muskulatur der Darmwand aufgelockert wird
- Er soll die Gebärmuttermuskulatur stimulieren
- Er soll für einen weicheren Muttermund sorgen
- Er soll ganz allgemein zur Entspannung der Schwangeren beitragen
Das alles hat ein Ziel: die Schwangere soll dadurch eine leichtere Geburt erleben.
Der Aufwand dieser Maßnahme ist überschaubar. Eine Tasse Tee ist schnell gekocht und die Schwangere, muss sich nicht einschränken (anders als beispielsweise bei der Louwen-Diät). Der Nutzen klingt gleichzeitig vielversprechend. Kein Wunder also, dass der Tee bei vielen Schwangeren beliebt ist. Zu kaufen gibt es ihn in der Apotheke, aber auch in jedem Drogerie-Markt. Doch es gibt auch Stimmen, die strickt von einer Verwendung abraten, da eine Studie den Konsum von Himbeerblättertee mit einer erhöhten Kaiserschnittrate in Verbindung bringen soll.
Höchste Zeit also, einen genaueren Blick auf die Forschung zu werfen:
Die Reise geht zurück bis ins Jahr 1941. Aus dieser Zeit gibt es zwei Arbeiten, die mit Himbeerblättern in Verbindung stehen. Die eine untersucht den Einfluss von Himbeerblättertee auf die Gebärmütter, Milzen (ja, das ist die Mehrzahl von Milz), Herzen und Blutgefäße von Katzen, Hunden, Hasen und Meerschweinchen in vitro (das heißt im Reagenzglas) und in vivo (das bedeutet im lebendenden Organismus). Die beiden Forscher (damals forschten vor allem Männer) Burn und Whitell fanden dabei einen bunten Blumenstrauß an Effekten von Himbeerblättertee, je nach Methode (in vivo oder in vitro), der Art des tierischen Gewebes (Herz, Milz, usw.), und der Ausgangslage der betrachteten glatten Muskulatur, also ob diese gerade locker oder angespannt war (Burn und Whitell, 1941). Um die Studienergebnisse der beiden Herren zusammenzufassen: in manchen Fällen wurden angespannte Muskeln durch den Himbeerblättertee entspannter, in anderen Fällen wiederum konnten sie entspannte Muskeln durch den Tee zu Kontraktionen angeren. Welche Bestandteile der Pflanze diese Wirkungen hervorriefen, und wie der Wirkmechanismus ist, also was Entspannung oder Anspannung auslöste, ließen die Forscher offen. Bereits einige Jahre später, 1954 weist deswegen ein anderes Forscherteam darauf hin, dass sich die sich teilweise widersprechenden Effekte möglicherweise durch Verunreinigungen erklären lassen. Zum Beispiel durch versehentlich falsch angewandte Reinigungsmethoden an Messgeräten und Reagenzgläsern. Eine Wiederholung der Ergebnisse gelang dem Forscherteam nämlich nicht (Beckett, Belthle und Fell, 1954).
Die andere Studie aus dem Jahr 1941 wurde an Menschen durchgeführt. Ein Herr Namens Whitehouse untersuchte dabei sage und schreibe drei Frauen, die vor kurzem entbunden hatten. Er verabreichte ihnen verschiedene Dosen des Himbeerblättertees fünf, sieben und acht Tage nach der Geburt und maß daraufhin die Kontraktionen im Uterus. Für alle Dosen konnte er Kontraktionen der Gebärmutter nach dem Konsum des Tees nachweisen (Whitehouse, 1941) und tatsächlich habe ich online immer wieder gelesen, dass diese Studie als Beweis für die positive Wirkung von Himbeerblättertee auf die Geburt herangezogen wird. Meine Meinung: Messungen an gerade einmal drei Frauen von vor mehr als 80 Jahren sind nicht repräsentativ. Noch dazu untersucht Whitehouse die Frauen postpartum, also nachdem sie entbunden haben. Hieraus Schlüsse für Geburten zu ziehen halte ich schon für sehr weit hergeholt.
Sehen wir uns nun einmal an, was die aktuelle Forschung zu dem Thema sagt. Glücklicherweise gibt es einige Übersichtsartikel neueren Datums zum Himbeerblättertee. Übersichtsartikel sehen sich immer die bereits veröffentlichten Publikationen an und versuchen, die darin beschriebenen Erkenntnisse zu bündeln und kritisch zu bewerten. Alle kommen zu dem Ergebnis, dass sich keine positiven Effekte des Tees auf die Geburt feststellen lassen (Holst et al. 2009; Dante et al. 2013; The European Medicines Agency 2013; Munoz Balbotin et al. 2019; Bowman et al. 2021). Besonders interessant ist dabei, dass sogar eine Doppelblindstudie zu der Wirkung von Himbeerblättern existiert. Was ist daran nun so erwähnenswert? Nun ja, mein Professor an der Uni hat immer gesagt, dass Doppelblindstudien so etwas wie der Goldstandard der medizinischen Forschung sind. Besser geht es nicht. Sie sind der Ferrari der wissenschaftlichen Studien und funktionieren folgendermaßen:
Alle Studienteilnehmer/innen werden zufällig in zwei Gruppen gelost. Eine Versuchsgruppe, die einen Wirkstoff erhält (z. B. in Tablettenform) und eine Kontrollgruppe, die ein Placebo bekommt (beispielsweise eine Tabletten ohne Wirkstoff). Die Proband/innen wissen dabei nicht, ob sie die Tabletten mit oder ohne Wirkstoff zu sich nehmen, sie nehmen sie also “blind” ein. Das ist das erste blind. Von einer Doppelblindstudie spricht man nur dann, wenn auch die Forschenden nicht wissen, wer in welcher Gruppe ist. Damit soll verhindert werden, dass sie absichtlich oder aus Versehen die Gruppenteilnehmer beeinflussen, z. B. weil sie sich verplappern oder sich unterschiedlich verhalten. Tritt nun bei der Versuchsgruppe (die mit Wirkstoff) häufiger ein Effekt auf, als bei der Kontrollgruppe, kann man davon ausgehen, dass der Wirkstoff tatsächlich wirkt. Findet man Effekte in beiden Gruppen, gehen diese höchstwahrscheinlich nicht über den Placebo-Effekt hinaus.
Zurück zu der Doppelblindstudie zum Himbeerblättertee. Sie stammt von einem australischen Team mit drei Forscherinnen und einem Forscher aus dem Jahr 2001. 192 erstgebärende Frauen ohne Risikoschwangerschaft wurden zufällig in eine von zwei Gruppen gelost. Die Versuchsgruppe bekam zwei Mal täglich 1,2 Gramm Wirkstoff aus Himbeerblättern in Tablettenform ab Schwangerschaftswoche 32. Die Kontrollgruppe erhielt eine Placebo-Tablette ohne Wirkstoff. Die beiden Gruppen hatten dabei sehr ähnliche Verteilungen des Alters der Frauen, beim Gewicht, oder der ethnischer Zugehörigkeit, aber auch bei Blutdruck und der Häufigkeit von Bluthochdruck. Das ist wichtig, um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Die Forscher/innen wollten wissen, ob sich die beiden Gruppen in folgenden Merkmalen unterscheiden: Länge der Schwangerschaft, Häufigkeit von Geburtseinleitungen (durch Infusionen oder Eröffnung der Fruchtblase), Verabreichen von Oxytocin oder Schmerzmitteln unter der Geburt, Geburtsart (Spontangeburt, Kaiserschnitt, Zangengeburt, Saugglockengeburt) und Dauer der einzelnen Geburtsphasen.
Die Ergebnisse sind ernüchternd. Die Forscher/innen können für die meisten der angegebenen Merkmale keine Unterschiede zwischen beiden Gruppen nachweisen. Lediglich ist in der Versuchsgruppe die zweite Phase der Entbindung etwas kürzer (im Durchschnitt 10 Minuten) und in der Gruppe gibt es etwas weniger Zangengeburten (19,3% in der Versuchsgruppe versus 30,4% in der Kontrollgruppe). Auch die Rate an manuellen Eröffnungen der Fruchtblase war in der Kontrollgruppe etwas geringer (von 58 Frauen, die diesen Eingriff hatten, waren 31 (54%) in der Kontrollgruppe). Wichtig zu erwähnen ist, dass alle drei gefundenen Effekte statistisch nicht signifikant sind, was bedeutet, dass die Irrtumswahrscheinlichkeit hoch ist. Angegebene Nebenwirkungen, wie Übelkeit, Übergeben, oder Durchfall kamen in beiden Gruppen gleichhäufig vor und können somit allgemeinen Schwangerschaftsbeschwerden zugeordnet werden (Simpson et al. 2001).
Zusammenfassend lässt sich sagen: Die bisherige Forschung kann nicht nachweisen, dass Himbeerblätter die Geburt schneller oder weniger schmerzhaft macht oder dass dadurch weniger Interventionen nötig sind.
Wie sieht es nun aber mit dem Gegenteil aus? Immer wieder lässt sich nachlesen, dass Himbeerblättertee mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für einen Kaiserschnitt in Verbindung gebracht wird.
Dies geht zurück auf eine sogenannte retrospektive Kohortenstudie von Nordeng et al. aus dem Jahr 2011. Die Forscher befragten 600 Frauen innerhalb der ersten 5 Tage nach der Geburt, ob sie vor der Entbindung bestimmte Kräuter zu sich genommen hatten. Insgesamt gaben 34 Mütter an, dass sie Himbeerblättertee getrunken haben. Unter diesen 34 Müttern war die Kaiserschnittrate signifikant höher, als bei den Frauen, die angaben, keinen Himbeerblättertee getrunken zu haben (24% Kaiserschnitte statt 9%). Deswegen wird mittlerweile teilweise von dem Tee abgeraten. Auch in meinem Geburtsvorbereitungskurs verwies die Hebamme auf diese Studie von Nordeng. Aus wissenschaftlicher Sicht ist das Ergebnis jedoch eher kritisch zu sehen. Die Frauen in der Studie wurden nicht nach der Menge des getrunkenen Tees befragt oder wie lange und wann sie ihn zu sich nahmen. Auch ist die Stichprobe mit 34 Frauen sehr klein und es ist gut möglich, dass hier eine Stichprobenverzerrung (Sampling Bias) vorliegt. Damit ist gemeint, dass sich möglicherweise genau die Frauen dazu entscheiden Himbeerblättertee zu trinken, die auch ein höheres Risiko für einen Kaiserschnitt haben und davon wissen. Beispielsweise weil sie bereits einen Kaiserschnitt in einer früheren Geburt hatten oder in einer Voruntersuchung erfahren haben, dass sie ein höheres Risiko für einen Kaiserschnitt haben. Es erscheint dann so, als ob der Tee für die höhere Kaiserschnittrate verantwortlich wäre. Eigentlich ist es aber so, dass Frauen mit einer höheren Präposition (Wahrscheinlichkeit) für einen Kaiserschnitt öfter Himbeerblättertee trinken.
Was bedeutet das nun für Dich als Schwangere? Kurz gesagt, es gibt nach aktuellen Erkenntnissen keinen Grund, Himbeerblättertee in der Schwangerschaft zu trinken. Ganz ehrlich, ich habe ihn aus Neugier probiert, und er schmeckt nicht sonderlich gut. Viel trinken in der Schwangerschaft ist jedoch wichtig. Ich würde dir daher empfehlen: trinke lieber den Tee, der dir gut schmeckt. Andersherum sehe ich die obengenannte Studie auch nicht als driftigen Grund, Himbeerblätter um jeden Preis zu meiden. Du musst also nicht in Panik verfallen, wenn Du aus Versehen einen Tee getrunken hast, in dem Himbeerblätter enthalten sind, wie es häufig in Schwangerschaftstees der Fall ist.
Und wichtig ist außerdem: Gerade, wenn Du Dir unsicher bist, suche immer den Rat von medizinischem Fachpersonal. Du hast während jeder Schwangerschaft Anspruch auf Beratung Durch ein/e Gynäkolog/in oder Hebamme. Wenn Du gesundheitliche Fragen hast, lass Dich von ihnen beraten und sieh Artikel wie diesen hier bitte nur als zusätzliche Informationsquelle.
Du hast Fragen zu dem Artikel? Etwas ist Deiner Meinung nach nicht richtig dargestellt oder falsch zitiert? Du hast Anregungen zu weiteren Themen? Lass es mich gerne wissen 🙂 !
Quellen:
Beckett, A., Belthle, F. and Fell, K. (1954): The active constituents of raspberry leaves; a preliminary investigation, in: J Pharm Pharmacol. ;1954 Nov.; 6(11): 785–796. doi: 10.1111/j.2042-7158.1954.tb11017.x.
Bowman, R., Taylor, J., Muggleton, S. et al. (2021): Biophysical effects, safety and efficacy of raspberry leaf use in pregnancy: a systematic integrative review, in: BMC Complement Med Ther 21, 56 (2021). https://doi.org/10.1186/s12906-021-03230-4
Burn J. and Withell E. (1941): A principle in raspberry leaves which RELAXES uterine muscle, in: Lancet. 1941; 238(6149):1–3. doi: 10.1016/S0140-6736(00)71348-1
European Medicines Agency Committee on Herbal Medicinal Products (2013); London, UK: Assessment Report on Rubus idaeus L., Folium
Holst, L., Haavik, S., and Nordeng, H. (2009): Raspberry leaf–should it be recommended to pregnant women? In: Complement Ther Clin Pract, 15(4), 204-208.
Muñoz Balbontín, Y., Stewart, D., Shetty, A., et al. (2019): Herbal Medicinal Product Use During Pregnancy and the Postnatal Period: A Systematic Review, in: Obstet Gynecol. 133(5), 920‐932.
Nordeng, H., Bayne, K., Havnen, G. C., et al. (2011): Use of herbal drugs during pregnancy among 600 Norwegian women in relation to concurrent use of conventional drugs and pregnancy outcome, in: Complement Ther Clin Pract. 17(3), 147‐151.
Simpson, M., Parsons, M., Greenwood, J., and Wade, K. (2001): Raspberry leaf in pregnancy: its safety and efficacy in labor, in: J Midwifery Womens Health 2001;46:51–9.
Whitehouse, B. (1941): Fragarine: an inhibitor of uterine action, in: Br Med J. 1941; 2(4210):370–371. doi: 10.1136/bmj.2.4210.370.
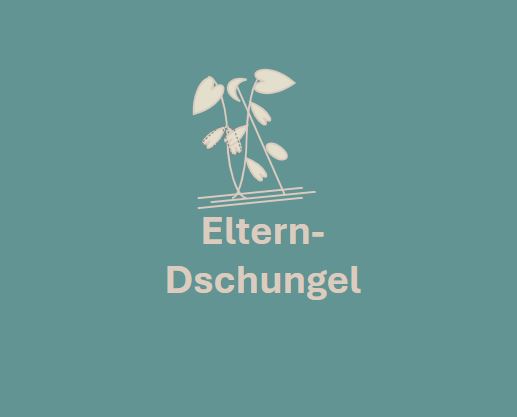
Schreibe einen Kommentar