
Im deutschsprachigen Raum stößt Frau beim Thema Geburtsvorbereitung meist recht schnell auf die Louwen-Diät. Sie geht zurück auf einen gewissen Prof. Dr. med. Dr. h. c. Frank Louwen (falls es Dich interessiert: Das steht für Professor, Doktor der Medi-zin, sowie Ehrendoktor (Dr. h. c.). Louwen steht für eine zuckerarme Ernährungsform in den letzten sechs Wochen vor dem errechneten Entbindungstermin. In dieser Zeit soll die Schwangere auf Zucker und leichtverdauliche Kohlenhydrate wie sie in Weiß-brot oder Nudeln zu finden sind, oder auch auf fruchtzuckerreiche Obstsorten verzichten. Die Diät verspricht einen positiven Einfluss auf das Schmerzempfinden während der Geburt. Doch was ist dran? Gibt es Belege die darauf hindeuten, dass die Ernährungsform etwas bringt? Oder ist das alles ziemlich großer Humbug?
Bevor wir zu der Forschungslage zur Louwen-Diät kommen können, möchte ich als erstes auf ein grundlegendes Problem hinweisen: Die Angaben, die online zu finden sind, darüber was „erlaubt“ ist und was nicht, sind teils widersprüchlich. Manche Quellen geben an, dass ein Verzicht auf Einfachzucker und Weizen ausreicht, Obst aber genossen werden kann und soll, um eine schmerzarme Geburt zu erleben. Andere Quellen raten zum Meiden von jeglicher Form von Gluten, welches auch in anderen Getreidearten als Weizen vorkommt. Somit wären bspw. auch Nudeln aus Dinkelmehl und Vollkornprodukte raus. Wieder andere Quellen legen zudem nahe, auch auf Obst weitestgehend zu verzichten, da hier zu viel Zucker enthalten sein soll.
Dem allen zugrunde liegt die folgende Hypothese: Der Konsum von Zucker oder stärkehaltigen Lebensmitteln führt zu einer Ausschüttung des Peptidhormons Insulin. Dieses soll einen negativen Einfluss auf das Schmerzempfinden während der Ent-bindung haben. Das Insulin wird in den Inselzellen der Bauchspeicheldrüse gebildet und „öffnet“ die Zellen der Muskeln, der Leber, der Nieren und des Fettgewebes. Damit sorgt es dafür, dass der Körper Glukose (Einfachzucker) zur Energiegewinnung nutzen kann. Es ist das einzige Hormon, das den Blutzuckerspiegel regulieren kann. Louwen geht nun davon aus, dass das Insulin an die selben Rezeptoren im weiblichen Körper andockt, wie das geburtsfördernde Prostaglandin (mehr zu den Prosta-glandinen findest Du in meinem Beitrag zu Datteln zur Geburtsvorbereitugn) und somit die Geburt hemmen kann. Beweise dafür liefert er nicht. Seine Annahme basiert ausschließlich auf seiner langjährigen Berufserfahrung in der Geburtshilfe und auf einer Studie aus dem Jahr 1994. In dieser lassen Forscher Mutterschafe und Stuten vor der Niederkunft für 30-48 Stunden fasten. Daraufhin wird deren Prostaglandin-Level bestimmt, welcher bei den fastenden Tieren höher ist, als bei nicht-fastenden. Die Forscher finden außerdem heraus, dass fastende Schafe stärkere Kontraktionen des Uterus während der Entbindung haben und dass die Stuten frühzeitiger lebensfähige Fohlen entbinden, als nicht fastende Muttertiere (Fowden, Ralph and Silver, 1994). Welche Aussagekraft dies für gebärende Frauen hat, bleibt offen und wird in keiner weiteren Studie untersucht.
Insgesamt mangelt es an Forschungsarbeiten, die sich mit der Louwen-Diät beschäftigen. Dies scheint auch deswegen der Fall zu sein, da sie außerhalb des deutschsprachigen Raums kaum bekannt ist. Eine Suche nach „louwen diet“ in Google Scholar, einer Wissensdatenbank für Forschungsarbeiten findet keinen Treffer.
Immerhin gibt es jedoch einige Papiere, die den Einfluss von Ernährung auf die fetale Entwicklung und die Geburt untersuchen. Im Fokus sind hierbei „low-glycemic diets“ also Diäten, die einen Fokus auf einen niedrigen glykämischen Index legen. Der glykä-mische Index gibt an, in welchem Zeitraum der Blutzuckerspiegel nach der Einnahme von Kohlenhydraten ansteigt. Beispielsweise enthalten Süßkartoffeln mehr Zucker als Kartoffeln, haben jedoch einen geringen glykämischen Index. Je niedriger der Wert, desto langsamer ist der Anstieg des Blutzuckers nach dem Essen. Niedrigglykämische Diäten legen damit einen Fokus auf Lebensmittel, die den Blutzuckeranstieg verlangsamen.
Zurück zur Wissenschaft: Zu finden ist eine Metanalyse, welche den Effekt von niedrigglykämischen Diäten während der Schwangerschaft untersucht. Die Meta-Analyse umfasst 11 klinische Studien mit insgesamt 1.985 Frauen. Dabei können die Forscher tatsächlich positive Effekte von Diäten mit einem niedrigen glykämischen Index feststellen: die Schwangeren haben einen reduzierten Nüchtern-Blutzuckerwert, sowie einen geringeren postprandialen Blutzucker (das ist der Blutzuckerspiegel, der 2h nach einer Mahlzeit gemessen wird). Außerdem sinkt das Risiko für „large for gestational age“ (LGA) Kinder. Das sind Neugeborene, die mit ihrem Geburtsgewicht oberhalb der neunzigsten Perzentile liegen, oder anders ausgedrückt: 90% der Neugeborenen gleichen Geschlechts sind kleiner (Zhang et al. 2016).
Zusammenfassend lässt sich sagen: die Metaanalyse gibt Hinweise darauf, dass die Mütter, die ihren Insulinspiegel durch die Diät im Gleichgewicht halten gesünder sind und die Kinder ein geringeres Geburtsgewicht haben (dieser Wert ist statistisch aber nicht signifikant). Über die Schmerzen während der Geburt sagt dies alles nichts aus. Außerdem weisen die Autor/innen der Metaanalyse darauf hin, dass in den meisten Studien Mütter untersucht werden, die ohnehin ein erhöhtes Schwanger-schaftsrisiko besitzen, bspw. weil sie Übergewichtig sind oder bereits unter Schwangerschaftsdiabetes leiden.
Eine ähnliche aber ältere Reviewarbeit aus dem Jahr 2010 sieht sich 8 Studien zu niedrig-glykämischen Diäten und LGA- bzw. SGA- („small for gestational age„) Kindern an. SGA-Kinder liegen unterhalb der 10. Perzentile, also sind 90% der gleichaltrigen des gleichen Geschlechts größer. Die Forschenden finden dabei keine Beweise von Vorteilen einer solchen Diät für „normale“ Schwangerschaften. Lediglich bei Frauen mit Diabetes mellitus stellen sie fest, dass diese geringere Mengen des Medikaments Insulin benötigen. Effekte für die Babys der Schwangeren werden dabei nicht gefunden (Louie et al. 2010). Aussagen, zum Schmerzempfinden während der Geburt lassen sich auch hier nicht ableiten.
Sehr interessant ist in diesem Zusammenhang dazu auch eine Studie des Weizmann Institutes. Die Forscher/innen finden hier heraus, dass der Blutzuckerspiegel zwischen Menschen sehr stark variieren kann, wenn sie das selbe essen. Sie untersuchten dafür 800 Proband/innen zwischen 18 und 70 Jahren. 54% von ihnen waren übergewichtig, 22% adipös, also stark übergewichtig. Teilnehmer/innen mit Typ 2 Diabetes waren jedoch von der Studie ausgeschlossen. Insgesamt nahmen die Proband/innen im Forschungszeitraum über 46.000 Mahlzeiten zu sich. Das über-raschende Ergebnis. Auch wenn die Teilnehmer/innen das gleiche aßen, hatten sie teilweise starke Unterschiede im Anstieg des Bluitzuckerspiegels. Die Forscher und Forscherinnen kommen dabei zu dem Schluss, dass das Verhalten des Blutzucker-anstiegs mit dem Darmmikrobiom zusammenhängt (Zeevi et al. 2015). Universelle Diätempfehlungen, die auf den Insulinspiegel abzielen, scheinen daher nur einen limitierten Nutzen zu haben. Der Glykämische Index ist jedoch eine feste Zahl für alle Menschen pro Lebensmittel. Die Studie zeigt damit, dass diese Zahl eher schlecht als Vorhersage dienen kann, wie der Blutzuckerspiegels eines Individuums und damit auch die Insulinausschüttung tatsächlich auf das Gegessene reagieren. In Berichten über den Forschungsartikel wird beispielsweise öfter über eine ältere Dame geschrieben, deren Blutzucker massiv auf den Verzehr von Tomaten reagierte. (Übrigens sind Tomaten nicht aus der Louwen-Diät ausgeschlossen 😉 ). Auch ist mittlerweile bekannt, dass es eine Rolle für den Insulinspiegel spielt, ob man zuckerhaltige Lebensmittel isoliert (z. B. als Keks zwischendurch), in Form von Getränken oder in Kombination mit Fetten, Proteinen oder Ballaststoffen zu sich nimmt. Auch macht es einen Unterschied, um kurzkettige Zucker, wie Fructose, oder eher langkettige Kohlenhydrate, wie in Vollkorngetreide gegessen werden.
Offen bleibt für mich die Frage, warum die Louwen-Diät noch nicht mit einer Studie untersucht wurde, da sie sich seit Jahren einer großen Popularität im deutsch-sprachigen Raum erfreut. Außerdem ist der Erfinder der Diät Professor und in der Regel führen Professoren auch Forschungsarbeiten durch oder vergeben diese wenigstens an Student/innen oder Doktorand/innen.
Aber egal, was der Grund für die fehlenden Untersuchungen ist: Solange es keine Beweise gibt, dass sie einen Vorteil für Dich als Schwangere bringt, ist es nicht empfehlenswert eine Maßnahme umzusetzen, auf die Du keine Lust hast. Glaubst Du an die Diät und möchtest sie unbedingt machen, steht Dir das natürlich frei. Wenn Du es aber nicht machst, dann hab kein schlechtes Gewissen. Hier scheint es allgemein sinnvoller, sich an die Regeln des gesunden Menschenverstands zu halten: Vollkornprodukte bevorzugen. Frisch und selbst kochen und viele unverarbeitete Lebensmittel konsumieren. Zucker lieber in Kombination mit anderen Nahrungsmitteln statt als Snack zwischendurch. Und wenn Du mal ein Eis oder ein Stück Kuchen isst, dann genieße es und lasse Dir nicht den Genuss von nicht belegten Ideen verhageln.
Und wichtig ist außerdem: Gerade, wenn Du Dir unsicher bist, suche immer den Rat von medizinischem Fachpersonal. Du hast während jeder Schwangerschaft Anspruch auf Beratung Durch ein/e Gynäkolog/in oder Hebamme. Wenn Du gesundheitliche Fragen hast, lass Dich von ihnen beraten und sieh Artikel wie diesen hier bitte nur als zusätzliche Informationsquelle.
Du hast Fragen zu dem Artikel? Etwas ist Deiner Meinung nach nicht richtig dargestellt oder falsch zitiert? Du hast Anregungen zu weiteren Themen? Lass es mich gerne wissen 🙂 !
Quellen:
Fowden, A. L., Ralph, M. M., Silver, M. (1994): Nutritional regulation of uteroplacental prostaglandin production and metabolism in pregnant ewes and mares during late gestation, in: Exp Clin Endocrinol. 1994;102(3):212-21. doi: 10.1055/s-0029-1211285. PMID: 7995343.
Louie, J. C. Y., Brand-Miller, J. C., Markovic, T. P. et al. (2010): Glycemic Index and Pregnancy: A Systematic Literature Review, in: Journal of Nutrition and MetabolismVolume 2010, Article ID 282464, 8 pagesdoi:10.1155/2010/282464.
Zeevi, D., Korem, T., Zmora, N. et al. (2015): Personalized Nutrition by Prediction of Glycemic Responses, in: Cell 163, 1079–1094 November 19, 2015 ª2015 Elsevier Inc. http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2015.11.001
Zhang, R., Han, S., Chen, GC. et al. (2016): Effects of low-glycemic-index diets in pregnancy on maternal and newborn outcomes in pregnant women: a meta-analysis of randomized controlled trials, in: Eur J Nutr 57, 167–177 (2018). https://doi.org/10.1007/s00394-016-1306-x.
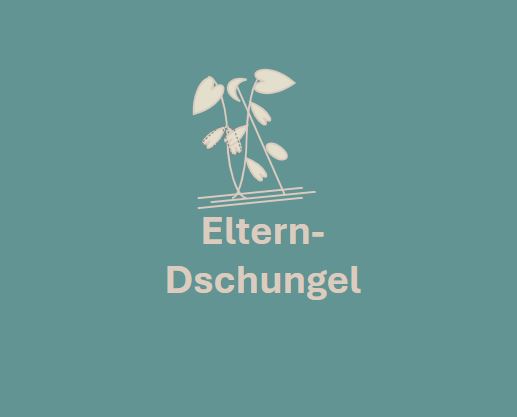
Schreibe einen Kommentar